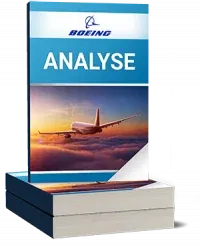Liebe Leserinnen und Leser,
es ist wieder soweit: Donald Trump hat seine Zollkeule geschwungen. Diesmal trifft es die Europäische Union mit angekündigten 50 Prozent Strafzöllen und Apple samt Samsung mit 25 Prozent auf Smartphones. Die Börsen reagierten prompt mit Kursverlusten, während Europas Politiker gewohnt besonnen zur Ruhe mahnten. Doch hinter der Routine verbirgt sich ein gefährliches Spiel, das die globalen Märkte zunehmend ermüdet.
Die ewige Wiederholung des Immergleichen
Trumps jüngster Zollvorstoß vom vergangenen Freitag folgt einem mittlerweile sattsam bekannten Muster. Früh am Morgen verkündete er auf Truth Social zunächst 25 Prozent Strafzölle auf Apple-Smartphones, falls das Unternehmen die iPhone-Produktion nicht in die USA verlagert. Wenig später dehnte er die Drohung auf Samsung und alle anderen ausländischen Smartphone-Hersteller aus. Der Höhepunkt folgte mit der Ankündigung von 50 Prozent Zöllen auf alle EU-Importe ab dem 1. Juni.
Die Begründung bleibt dieselbe wie immer: Die EU sei „schwierig zu handhaben“ und die Verhandlungen würden „nirgendwohin führen“. Dabei hatte die Europäische Union erst diese Woche ein neues Handelsabkommen vorgeschlagen, das gemeinsame Zollsenkungen bei Industriegütern, besseren Zugang für amerikanische Agrarprodukte und sogar die Zusammenarbeit bei KI-Rechenzentren vorsieht.
Doch Trump interessiert sich offenbar nicht für konstruktive Lösungen. „Wir haben den Deal festgelegt. Er liegt bei 50 Prozent“, erklärte er im Oval Office und machte deutlich, dass er nicht nach einem Kompromiss sucht. Seine Verhandlungsstrategie bleibt unverändert: Maximaldruck durch öffentliche Drohungen, gepaart mit der Hoffnung, dass der Kontrahent klein beigibt.
Wenn die Keule stumpf wird
Das Problem mit Trumps Zoll-Diplomatie liegt nicht nur in ihrer Aggressivität, sondern vor allem in ihrer Berechenbarkeit. Was einst überraschend und damit wirkungsvoll war, ist inzwischen zur Routine geworden. Die Finanzmärkte haben gelernt, zwischen theatralischen Drohungen und tatsächlicher Politik zu unterscheiden.
Der S&P 500 verlor am Freitag zwar 0,7 Prozent, der Nasdaq 100 rutschte um 0,9 Prozent ab. Doch diese Reaktion fiel deutlich milder aus als bei früheren Zollankündigungen. Apple verlor immerhin drei Prozent, nachdem Trump dem Technologiekonzern mit Strafzöllen gedroht hatte. Doch Analysten bleiben gelassen. Sie glauben, dass das Konzept, iPhones in den USA zu produzieren, ein Märchen ist, das nicht umsetzbar ist. Ein iPhone aus amerikanischer Produktion würde laut Bank of America die Herstellungskosten nahezu verdoppeln und könnte 3.500 Dollar kosten.
Europa spielt auf Zeit
Die europäische Reaktion folgt ebenfalls einem bekannten Drehbuch. Politiker mahnen zur „Ruhe“ und betonen ihre Bereitschaft zu Verhandlungen, während im Hintergrund bereits Vergeltungsmaßnahmen vorbereitet werden. „Das ist alles Teil der Verhandlung“, erklärte der niederländische Premierminister Dick Schoof mit bemerkenswerter Gelassenheit.
Hinter den beschwichtigenden Worten verbirgt sich jedoch eine klare Strategie. Die EU hat bereits Vergeltungszölle auf US-Waren im Wert von 21 Milliarden Euro vorbereitet und arbeitet an einer zusätzlichen Liste für 95 Milliarden Euro amerikanische Produkte. Boeing-Flugzeuge, US-Autos und Bourbon stehen dabei im Fokus.
Die Europäer setzen darauf, dass Trumps Drohungen erneut verpuffen. Schließlich hat er bereits bei China einen ähnlichen Rückzieher gemacht, als die Finanzmärkte im Mai negativ reagierten. Die 145 Prozent Zölle auf chinesische Importe wurden schnell wieder auf ein erträgliches Maß reduziert.
Das Handelsdefizit-Dilemma
Dabei wäre eine Reduzierung des amerikanischen Handelsdefizits durchaus sinnvoll. Die USA importierten 2024 Waren im Wert von 4,3 Billionen Dollar, während sie nur 2,1 Billionen Dollar exportierten. Dieses strukturelle Ungleichgewicht schwächt langfristig die amerikanische Wirtschaft und macht das Land abhängig von ausländischen Krediten.
Doch Trumps Methoden sind kontraproduktiv. Strafzölle verteuern importierte Waren für amerikanische Verbraucher und Unternehmen, ohne die grundlegenden Wettbewerbsprobleme der heimischen Industrie zu lösen. Gleichzeitig provozieren sie Vergeltungsmaßnahmen, die amerikanische Exporteure treffen.
Eine nachhaltige Lösung würde Investitionen in Bildung, Infrastruktur und Technologie erfordern, um die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Unternehmen zu stärken. Stattdessen setzt Trump auf protektionistische Maßnahmen, die kurzfristig populär sind, langfristig aber wirtschaftlichen Schaden anrichten.
China bleibt das eigentliche Ziel
Hinter den aktuellen Drohungen gegen Europa verbirgt sich eine größere Strategie. Trump will offenbar ein Bündnis gegen China schmieden und übt deshalb Druck auf traditionelle Verbündete aus. Die EU soll weniger mit China handeln und stattdessen mehr amerikanische Produkte kaufen.
Doch diese Rechnung geht nicht auf. Europa hat eigene wirtschaftliche Interessen und wird sich nicht zu einem Juniorpartner in Trumps Anti-China-Koalition degradieren lassen. Die 90-tägige Pause bei den China-Zöllen zeigt zudem, dass auch dort die Verhandlungen stocken.
Märkte wenden sich ab
Die Finanzmärkte reagieren zunehmend allergisch auf Trumps Handelspolitik. Während amerikanische Aktien seit Jahresbeginn stagnieren, legen europäische Indizes deutlich zu. Der Stoxx Europe 600 gewann in den vergangenen Monaten an Boden, während der S&P 500 mit der vierten Verlustserie in Folge kämpft.
Investoren beginnen, ihre Portfolios zu diversifizieren und reduzieren ihr US-Engagement. „Europa und China werden den Großteil der wirtschaftlichen Schmerzen durch Zölle tragen“, warnt Wells Fargo. Doch gleichzeitig werden Anlegern gewarnt, „nicht vom Regen in die Traufe zu kommen“ – ein indirekter Hinweis darauf, dass auch amerikanische Assets unter Druck stehen.
Die Ironie ist perfekt: Trump wollte Amerika wieder groß machen, doch seine Politik macht amerikanische Investments zunehmend unattraktiv. Währenddessen profitiert Europa von der Planungssicherheit und einer berechenbareren Politik.
Gefährliche Routine
Trumps Problem liegt in der Abnutzung seiner Drohkulisse. Was einst Schockwirkung hatte, wird inzwischen als kalkulierbare Verhandlungstaktik eingepreist. Die Märkte haben gelernt, zwischen Lärm und tatsächlicher Politik zu unterscheiden.
Doch diese Routine birgt Gefahren. Wenn Trump seine Glaubwürdigkeit verliert, könnte er zu noch drastischeren Maßnahmen greifen, um wieder Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Eskalationsspirale dreht sich dann immer schneller, bis sie außer Kontrolle gerät.
Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Trump bereit ist, seine Drohungen wahrzumachen oder ob er erneut einen Rückzieher macht. Die Wahrscheinlichkeit für Letzteres steigt mit jedem Tag, an dem die Märkte gelassen auf seine Ankündigungen reagieren.
Das Murmeltier grüßt also täglich, doch die Zuschauer werden müde. Trump mag das noch nicht begriffen haben, aber seine Zollkeule wird mit jedem Schwung stumpfer. Irgendwann wird sie ganz wirkungslos sein – und dann steht der selbsternannte Deal-Maker ohne Verhandlungsmasse da.
Boeing-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Boeing-Analyse vom 30. August liefert die Antwort:
Die neusten Boeing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boeing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. August erfahren Sie was jetzt zu tun ist.